Infos zu den
Studien- und Prüfungs-Leistungen
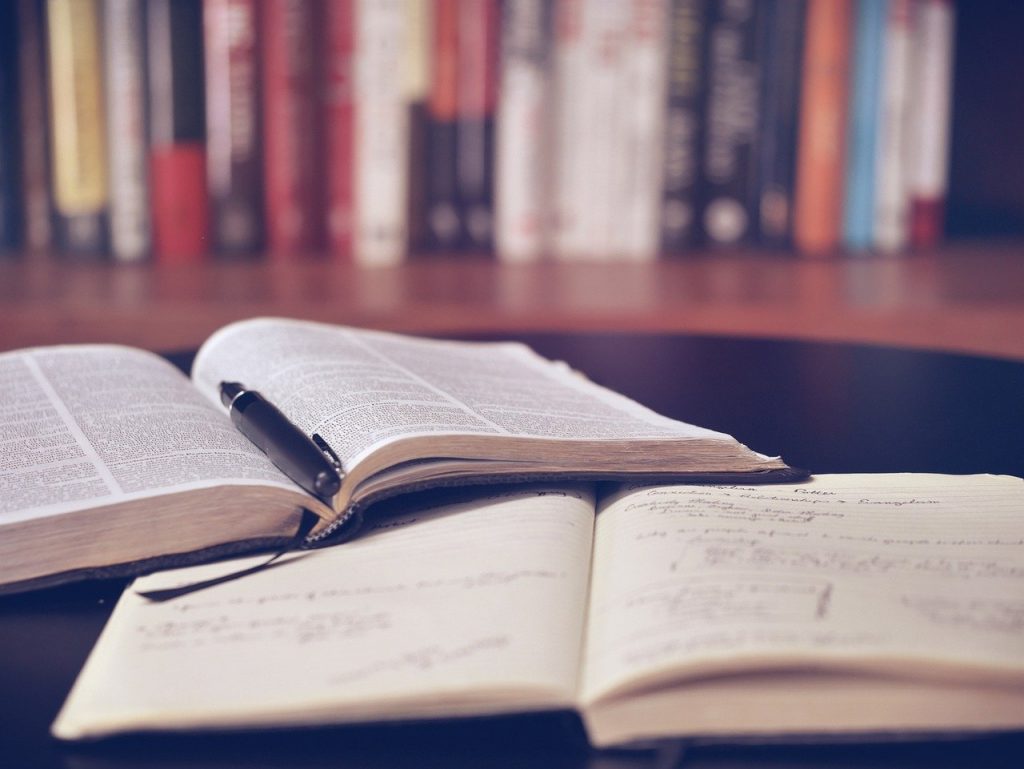
Scheinvoraussetzungen
letzte Überarbeitung: WS 2021/22
Diese Seite ist Work in Progress und erhebt deswegen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn du Fehler findest oder Sachen die hier noch nicht stehen, die aber notwendig sind, dann schreibe mir einfach eine Mail.
Die Aussagen zur Studienleistung und zur Prüfungsleistung, die du auf dieser Seite findest, beziehen sich nicht explizit auf das Seminar für das du gerade deine Leistung erbringen möchtest. Wenn hier also von Film, Hörbuch,
Hörspiel oder anderem die Rede ist, so solltest Du diese Wörter durch das jeweilige Seminarthema zu dem die Leistung erbracht wird ersetzen.
Studienleistung
Referat (Vortrag mit Handout zu einem Thema) → Infos unten
oder Essay (1500 Wörter) → Infos unten
oder Praktische Arbeit (mit kurzem Papier oder Gespräch) → Infos unten
Nur für Das Seminar zu Hörbuch und gehörtem Buch: eigene Lesung eines Buchs oder Vorstellung eines selbsterstellten Hörbuchs innerhalb der Seminarsitzungen.
Modulabschluss
Hausarbeit (3000 Wörter) → Infos unten
oder Praktische Arbeit (mit kurzem Reflexions-Papier oder Gespräch) → Infos unten
Nur für Das Seminar zu Hörbuch und gehörtem Buch: Erstellung eines Hörbuchs im Team innerhalb der Seminarsitzungen.

Infos zu den Referaten
Während des Referats wird ein Thema für die übrigen Sitzungsteilnehmer_innen vorbereitet und didaktisch aufbereitet.
Es gibt zwei verschiedene Typen von Referaten, die entsprechend verschieden in die Sitzungen eingebunden sind.
1. die klassische Form des Referates stellt einen Text oder ein Buch oder eine zusammenfassende Untersuchung von Internetseiten, Hörspielen, Filmen, etc. innerhalb der Sitzung vor. Bei diesem Referat wird davon ausgegangen, dass die Zuhörenden sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Es soll seinen Gegenstand ansprechend aufbereiten. Dass bei den Zuhörenden vorausgesetzte Wissen, nutzt die bis dahin im Seminar erarbeiteten Zusammenhänge und stellt das neue Thema auf dieser Grundlage vor. Wichtig ist also das Referat nicht zu halten, damit man ein Schein bekommt, sondern das Referat so zu konzipieren, dass es für alle Beteiligten im Seminar einen Erkenntnisgewinn bedeutet und sich in die Gesamtstruktur des Seminarplans einfügt. Dabei soll es beim Vortrag (evtl. mit Bildern, Tönen, etc.) bleiben und keine anderen Mittel der Diskussion oder Sitzungsgestaltung eingesetzt werden. In der vorgesehenen Gesamtzeit für das Referat sollte neben dem Vortrag auch Zeit für Nachfragen eingeplant werden. Zum Referat gehört notwendig ein Handout mit den wichtigsten Informationen.
2. die in meinen Seminaren häufiger verwendete Form des Referats basiert auf einem Text, einem Hörspiel, einem Film, etc. der/die von den Teilnehmenden zur Sitzung vorbereitet wurde und deshalb bekannt ist. Der Text sollte von den Referierenden spätestens in der Sitzung davor bekannt gegeben werden. Entsprechend macht es keinen Sinn, den Inhalt noch einmal zusammenzufassen, sondern das Referat besteht darin, Zusatzinformationen aufzubereiten und die Sitzung während der Referatsdauer zu gestalten. Die Gestaltung der Sitzung kann klassisch frontal oder aber als Artistic Research oder in anderen Weisen geschehen. Wichtig ist das Form und Inhalt des Referates zusammenpassen. Es geht also nicht darum sich selbst darzustellen, sondern darum, das Thema in der Sitzung angemessen zu bearbeiten. Hierzu können zum Beispiel Fragen der Gegenstand aufwirft formuliert werden, die dann im Seminar diskutiert werden. Oder es können verschiedene Filmausschnitte miteinander verglichen werden. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, soweit sie sich dabei um den Gegenstand kümmert. Auch für diese Form des Referates gilt: dass es für alle Beteiligten im Seminar einen Erkenntnisgewinn bedeuten und sich in die Gesamtstruktur des Seminarplans einfügen soll. Zum Referat gehört notwendig ein Handout mit den wichtigsten Informationen und einer Art Ergebnisprotokoll der Diskussion der Sitzung. Dies Handout wird in der auf die Referatssitzung folgenden Sitzung verteilt.
Infos zu den praktischen Arbeiten
Bei einer praktischen Arbeit sind zwei Dinge ausschlaggebend: einerseits der Umfang der für sie benötigten Zeit und andererseits (wichtiger) die Qualität der Arbeit und die mit ihr verbundenen Überlegungen. Nach diesen Kriterien wird die Arbeit auch einmal als Studienleistung und ein anderesmal als Modulabschluss gewertet.
Die Arbeit soll in sich stimmig sein. Das heißt auch, Inhalt und Form sollen sich ergänzen und gegenseitig erweitern. Je nach Seminarthema kann die Arbeit sowohl eine Art Hörspiel, Hörbuch oder Feature sein, als auch ein Song mit entsprechender Soundbearbeitung, als auch ein neu mit Sounds versehenes Anime (oder ein alter Kurzstummfilm), als auch ein neues Sunddesign für Gebrauchsgegenstände des Alltags entwickeln, als auch eine eigene Radiosendung (Reportage, interaktive Sendeformate, usw.), etc. Da hast Du die freie Wahl.
Die Arbeit muss aber dennoch zuvor mit mir abgesprochen sein, um sicherzugehen, dass sie als Leistung für das Seminar anerkannt werden kann. Neben der direkten Ausarbeitung des Stücks, etc. solltest Du Dir Gedanken zu den kulturellen Zusammenhänge machen, innerhalb derer Deine Arbeit steht. Diese Gedanken sollen sowohl für die Ausarbeitung mitleitend sein, als auch in deiner schriftlichen oder mündlichen Reflexion zur Arbeit ausgedrückt werden.
Sowohl die schriftliche Reflexion als auch die im Gespräch stattfindende Reflexion (auch hier hast du wieder die freie Wahl) folgen dem selben Muster:
- Für die Reflexion ist wichtig, worum es Dir bei Deinem Projekt ging, wie Du zur entsprechenden Auswahl von Text, Sprecher*innen, etc. gekommen bist. Welche Zielgruppe hat Dein Projekt?
- Welche Probleme sind eventuell aufgetaucht, ließen sie sich lösen? Wie ließen sie sich lösen? Hat sich die Arbeit im Zuge des Produktionsprozesses verändert?
- Um diese Fragen zu beantworten, sollten auch ein bis zwei Details aus der Arbeit entsprechend beleuchtet werden
- Also im Großen und Ganzen: Warum ist die Arbeit so wie sie ist? Welche Überlegungen stecken dahinter?
- Aber auch: wie bewertest Du Deine Arbeit? Ein Versuch kann ja auch zeigen, dass ein Plan nicht funktioniert.
- Darüberhinaus: Wie ist die Arbeit in den Kontext anderer Arbeiten einzuordnen? Was für eine Art von „Werk“ ist es, was ist es nicht?
- Wenn es sich anbietet, so sollten auch die kulturwissenschaftlichen Zusammenhänge in denen die Arbeit steht berücksichtigt werden.
- Im Gespräch kann es auch noch darum gehen, dass ich Dir Fragen zur Technik oder Herangehensweise zu beantworten versuche.
Dies alles können wir nur sehr kurz ansprechen. Es ist ja ein Gespräch und kein Vortrag. Und auch in Papierform sollte die Reflexion 2-3 Seiten nicht überschreiten.
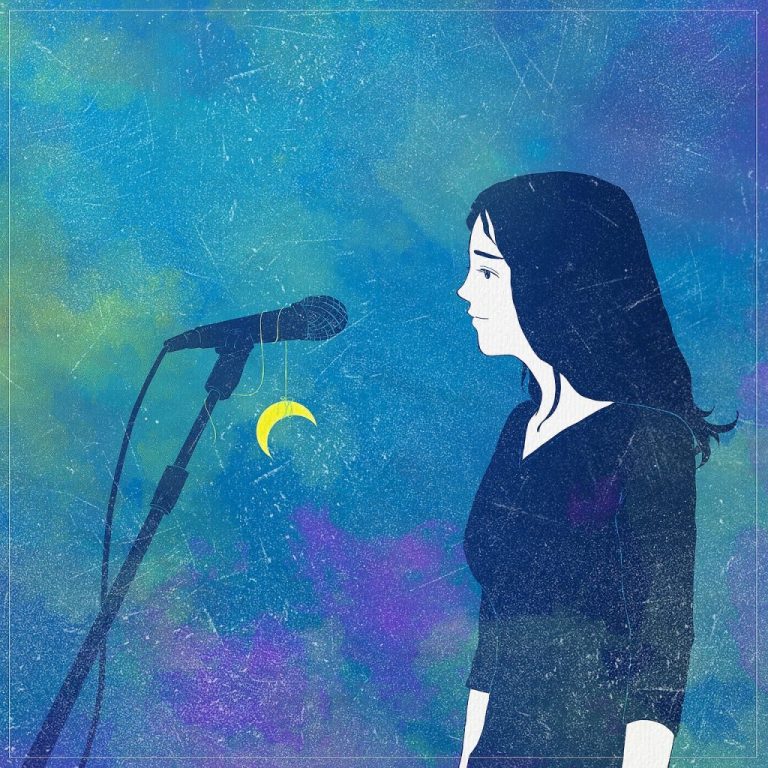
Formales zu
Essay & Hausarbeit
Bitte unbedingt als PDF schicken !
(Bestätigungsauffordserung für Empfang der Email nicht vergessen).
Deckblatt:
Universität Hidesheim
Institut für Medien, Theater und populäre Kultur
Titel der Lehrveranstaltung
Nummer der Lehrveranstaltung im LSF
Semester (SS WS Jahr)
Dozierende:r
Verfasser:in
Titel der Arbeit
Art der Arbeit: Essay oder Modulabschluss-Hausarbeit
genauer Modultitel (Modul und Teilmodul) (auch für die spätere POS-Eintragung)
Student:in:
Name, Vorname
Matrikelnummer
Studiengang
Anzahl der Fachsemester (Benotungen hängen auch von den Fachsemestern ab)
Email-Adresse
evtl. Telefonnummer
zuständiges Prüfungsamt:
Zuständige:r beim Prüfungsamt:
Text:
ca. 1500 Wörter (Essay) / ca. 3000 Wörter (Hausarbeit)
!! wichtiger als die genaue Zahl ist die geschlossene Darstellung Eurer Gedanken. Weniger Wörter sind aber fast immer zu wenig. !!
5 (fünf !!!) cm Rand auf der rechten Seite
Seitenzahlen
Schrift:
Times New Roman, Garamond oder ähnliche in Schriftgröße 12
Arial oder ähnliche in Schriftgröße 10
Abstand 1½ -Zeilig
Bibliograhie:
Name, Vorname[ (Hg.)] (Jahr): Titel. Untertitel. [In: Vorname Name (Hg.): Titel. Untertitel.] [wahlweise: Verlag,] Ort [,S. x-xx] .
Name, Vorname: Hörstücktitel. Untertitel. [Versionshinweis.] Sender [Autorenproduktion] Jahr.
Name, Vorname: CD-Titel. CD-Verlag. CD-Kennungsnummer, Jahr.
Infos zu den schriftlichen Arbeiten
Es soll sich um wissenschaftliche Arbeiten handeln.
Wissenschaftliche Aussagen bestehen nicht nur aus subjektiven Urteilen und Meinungen der Untersuchenden, sondern müssen allgemein nachvollzogen werden können. Wo Meinungen und Urteile gefällt werden, müssen diese expliziert und begründet werden.
Dogmatismus ist zu vermeiden, und zwar dadurch, dass als Grundhaltung eine skeptische, kritische Haltung gegenüber dem Wissen eingenommen wird. Dies bedeutet nicht, dass alles kritisiert werden muss, aber wohl, dass alles Wissen, bevor es verwendet wird, kritisch geprüft wird.
Alles Wissen muss an die disziplinäre (manchmal auch interdisziplinäre) Wissenssystematik des Faches angebunden werden. Wissen steht nicht für sich allein, sondern ist immer im Kontext des bereits vorhandenen Wissens darzustellen und einzuordnen.
Themenfindung
Das Thema der Arbeit sollte mit mir abgesprochen sein, um zu verhindern, dass die Arbeit aufgrund ihres Arbeits-Umfangs oder des fehlenden thematischen Bezugs aufs Seminar nicht anerkannt werden kann. So soll auch verhindert werden, dass sich für eine Arbeit von 1500 Wörtern ein zu allgemeines Thema ausgesucht wird, dass dann nur in wenig wissenschaftlichen Allgemeinplätzen dargestellt würde.
Du kannst das Thema darüber hinaus selbst wählen. Wichtig ist der Bezug auf das Oberthema des Seminars. Es können also Fragestellungen, die im Seminar aufgekommen sind, vertieft werden oder aber Fragestellungen erörtert werden, die zwar zum Thema gehören, es aber aufgrund der begrenzten Zeit nicht ins Seminar geschafft haben.
Die Arbeit sollte entlang einer These oder einer Fragestellung entwickelt werden. Die Thesen oder Fragestellungen können eigene sein oder aber vorgefundene (wissenschaftliche Literatur oder Allgemeinwissen). Finde also heraus, was dich am Thema besonders interessiert und entwickelt daraus den roten Faden, der die Arbeit zusammenhält. Dabei ist es normal, dass nicht alles was es zum Thema zu sagen gäbe, auch in die Arbeit aufgenommen werden kann.
Allgemeines zur Form
Die gewählte Form für die schriftliche Arbeit hängt vom bearbeiteten Inhalt und dem Umgang mit demselben ab.
Auch wenn der Standart häufig eine erklärender, linear gestalteter Text ist, der aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss (Fazit/Ausblick) besteht und (bei größeren Arbeiten unvermeidlich) im Hauptteil in Kapitel untergliedert werden kann, für die man sich möglichst frühzeitig einen logischen Aufbau überlegen sollte. So ist es dennoch möglich ganz andere „Text“-formen auszuwählen.
Diese können zum Beispiel eine Website oder ein Dialog oder eine Zettelsammlung sein oder auch in ganz anderen Formen abgegeben werden. Also zum Beispiel als Podcast (auch dann wenn das Seminarthema nicht Podcasts ist) oder als Feature oder als Performance. Der Fantasie sind hier nur in einer Hinsicht Grenzen gesetzt: es ist unumgänglich, dass der Bezug zum Thema der Arbeit eindeutig zu erkennen ist und durch das gewählte Format reflektiert wird.
Allgemeines zur Gestaltung des Inhalts
Über diese Form hinaus besteht die Leistung in einer inhaltlich korrekten Ausführung der einzelnen Kapitel (oder anderen Teile).
Die Arbeit sollte eine klare Argumentationslinie verfolgen (einen roten Faden).
Den thematischen, logischen und organisatorischen Mittelpunkt einer Seminararbeit macht eine bestimmte Fragestellung oder These aus. Versuche Dir Klarheit über die konkrete Fragestellung oder These zu verschaffen. Diese sollte in der Einleitung als Problemaufriss klar dargelegt und die dort gemachten Vorgaben sollten im Verlauf der Arbeit auch wirklich eingelöst werden.
Die Arbeit soll aus einem eigenständigen und übersichtlich gegliederten „Text“ und nicht aus einer Collage von Zitaten und Aphorismen bestehen, es sei denn, dies ist expliziter Bestandteil der Form.
Für die Arbeit sollte sich einer prägnanten und dem wissenschaftlichen Diskurs angemessenen Sprache bedient werden und von der Verwendung von Allgemeinplätzen, Jargon und „lockeren“ Formulierungen absehen werden. Auch hier gilt wieder: die Sprache soll der Form angemessen sein, was in einigen Fällen zu Ausnahmen des zuvor Gesagten führen kann.
Die Grundlage für den eigenen Text besteht einerseits aus dem im Seminar erarbeiteten Themen und Texten und zum anderen in der Rezeption von Texten und künstlerischen Arbeiten, die das eigene Thema bearbeiten und vielleicht nicht im Seminar vorgekommen sind. Zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört, angesichts der meist sehr großen Menge von Texten und künstlerischen Arbeiten eine sinnvolle Auswahl für die Bearbeitung des eigenen Themas zu treffen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, sich Tipps und Anregungen zum eigenen Arbeiten in einer Sprechstunde bei mir zu holen.
In einer medienwissenschaftlichen Arbeit geht es vor allem darum, zum Beispiel Medienprodukte unter Zuhilfenahme medientheoretischer Überlegungen (besonders Theorien zu Hörkunst und Audiokultur) einer kritischen Analyse zu unterziehen oder aber bestimmte Theorien zum Beispiel anhand ausgewählter Medienprodukte auf ihre Tragfähigkeit hin zu überprüfen. Die Arbeit soll das gestellte Thema im Rahmen des Möglichen so bearbeiten, dass die relevantesten Fragen aufgeworfen und auch unter Zuhilfenahme von Sekundärliteratur diskutiert werden.
Die Nutzung von Texten und der Einsatz von Zitaten setzt voraus, dass z. B. Theorien oder Argumente anderer Autor*innen, die wiedergegeben werden, wirklich verstanden wurden. Das sie also auch in eienen Worten wiedergegeben werden können.
Zudem muss stets erkennbar sein, was diese Theorien oder Argumente mit dem Thema der eigenen Arbeit zu tun haben. Also kein Namedropping oder Zitate aufhäufen ohne Bezug auf die eigene Argumentation.
Bei der Darstellung empirischen Datenmaterials muss vor allem bewusst entschieden werden, welche Indikatoren zur Dokumentation bestimmter Sachverhalte ausgewählt werden.
Zur Einordnung von Literaturbeiträgen ist es wichtig, sich den Kontext, in dem eine Veröffentlichung entstanden ist, klarzumachen. Man sollte bei Büchern unbedingt auch (!) Vorwort und Einleitung lesen und bei Zeitschriftenbeiträgen auch auf die Herausgeber*innen achten.
Die Biographie eines Autors oder Regisseurs, die Produktionsdaten oder die Entstehungskontexte zum Beispiel eines Medienprodukts sind nur dann zu erläutern, wenn sie für die Bearbeitung des Themas unerlässlich sind (in Fußnoten ist selbstverständlich gegebenenfalls auf Produktionsdaten etc. zu verweisen).
weiterer Aufbau der Arbeit
Ein stichwortartiges Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben soll bei längeren Arbeiten (ab 10 Seiten) einen ersten Eindruck vom Aufbau und Gedankengang der Arbeit geben.
Die Einleitung zeigt die Fragestellung, das Ziel und eventuell die Untersuchungsmethode auf (siehe auch oben).
Beispielsweise kann dargelegt werden, inwieweit die Fragestellung problemhaltig ist, Rätsel aufwirft oder scheinbar Widersprüche enthält, oder auch warum das Thema zum Verständnis der Primärquelle(n) wichtig ist. Auswahlkriterien werden erläutert. Manchmal wird eine Arbeits(hypo)these formuliert.
Der Hauptteil (der nicht so betitelt werden muss !!) gliedert sich häufig in aussagekräftige Überschriften.
Die Fragestellung oder Hypothese wird systematisch untersucht, wobei eine klare Argumentationsstruktur grundlegend ist. Entscheidend sind die logische Entwicklung von Gedanken, durch Verknüpfung in Sätzen, Absätzen und Abschnitten durch geeignete logische Konnektoren und die Beschränkung eines Absatzes oder Abschnittes auf einen Hauptgedankengang. Schlussfolgerungen werden anhand der Analyse des zu untersuchenden Gegenstandes entwickelt. Die Schlussfolgerungen müssen nachvollziehbar sein.
Hierzu sollten wissenschaftlich übliche oder erarbeitete Begriffe einheitlich und konsistent verwendet werden. Lexikonbestimmungen der verwendeten Begriffe sind unnötig, weil sie ja schon im Lexikon stehen.
Thesen und Analyseergebnisse sollten durch Beispiele aus den untersuchten Primärquellen belegt werden. Diese Beispiele sollten interpretiert werden, also nicht nur illustrierend eingefügt werden.
Es sollen soweit wie möglich und – sofern vorhanden – auch Beispiele berücksichtigt werden, die sich – wenn auch nur scheinbar – nicht in Übereinstimmung mit Deinen Thesen bringen lassen.
Die gewonnenen Erkenntnisse müssen anhand der Primärquelle überprüfbar sein.
Die Schlussbetrachtung greift die Fragestellung wieder auf und fasst die Ergebnisse abstrahierend zusammen oder zeigt weiterführende Aspekte auf. Dabei sollte allerdings vermieden werden, im Schlussteil der Arbeit Fässer aufzumachen, die mit dem Thema zusammenhängen, allerdings bis hier noch nicht erarbeitet wurden. Weiterführende Aspekte sollten also möglichst auf die eigene Darstellung bezogen werden. Nicht alles, was es noch zum Thema zu sagen gäbe, hat seinen Ort im Fazit.
Zum Schluss einige ergänzende Hinweise: Vermeide bloße Paraphrasen Deiner Quellen, vage Formulierungen (in gewisser Weise, eigentlich, im Grunde, etc), umgangssprachliche Wendungen, leere Generalisierungen, bloß subjektiv wertende Adjektive, Wiederholungen oder eine unangemessene metaphorische Ausdrucksweise. Ein beliebter Trick in der wissenschaftlichen Literatur besteht darin, eine Aussage erst zu relativieren („vielleicht“, „könnte man auch sagen“) und dann auf dieser Basis die nächsten Schlüsse zu ziehen, als hätte man einen wissenschaftlichen Beleg gebracht. Dies ist aber keine Argumentation, sondern ein Trick, der vermieden werden sollte.
Recherchieren
Hausarbeiten können sich selbstverständlich nicht auf die gesamte aktuelle Literatur zu einem bestimmten Themenkreis stützen. Es sollte aber ersichtlich sein, dass du dich darum bemüht hast, auch selbstständig relevante Literatur zu deinem Thema zu finden.
Bei der Literatursuche empfiehlt es sich, in drei Schritten vorzugehen:
Um sich einen ersten Überblick über das Thema zu verschaffen bietet es sich neben einer Internetrecherche an, einschlägige Artikel in Nachschlagewerken zu lesen und sich die dort aufgeführte Literatur zu beschaffen, die ihrerseits wieder Literaturhinweise enthält. Auch die Seminarliteratur enthält Literaturlisten, die als Ausgangspunkt für die eigene Recherche gelten können.
Außerdem solltest du eine Schlagwortsuche im elektronischen Katalog der Bibliothek starten.
Du solltest nicht wahllos Sekundärliteratur kompilieren, sondern dir erst darüber klar werden, wie die Themenstellung lautet und welche Sekundärtexte im Hinblick darauf relevant sind. Diese sollten dann in die Argumentationslinie eingearbeitet werden.
Wir müssen nicht so tun, als würden wir das Rad immer wieder neu erfinden. Und es wäre wissenschaftlich unredlich, wenn man die Herkunft (und damit auch den Zusammenhang) der wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht angibt.
Zitieren
Die Behauptungen und Argumente der behandelten Autoren sollten möglichst in eigenen Worten wiedergegeben werden. Wörtliche Zitate dienen zum einen dazu, zu belegen, dass jemand eine bestimmte Auffassung tatsächlich vertritt, zum anderen sind sie angebracht, wenn es auf die wörtliche Formulierung eines bestimmten Gedankens bzw. auf eindeutige Begriffsdefinitionen ankommt. In keinem Fall entbinden Zitate davon, in eigenen Worten zu erläutern, was das Zitat bedeutet. Manchmal stellt sich danach heraus, dass der Text doch auf das wörtliche Zitat verzichten kann.
Auf keinen Fall sollte die Hausarbeit aus einen Aneinanderreihung von Zitaten bestehen, die die eigene Argumentation ersetzen!
Wörtliche Zitate sind unverändert in den Text zu übernehmen, also inklusive kursiver Passagen etc. Sämtliche Änderungen gegenüber dem Originaltext sind kenntlich zu machen. Auslassungen sind mit runden Klammern und drei Punkten (…) zu dokumentieren, Hinzufügungen sind mit eckigen Klammern [ ] zu versehen.
Auslassungen oder Hinzufügungen dürfen nicht den Sinn des Zitats verfälschen.
Die Herkunft der Zitate wie auch die der übernommenen Gedanken ist exakt anzugeben. Nachzuweisen sind also nicht nur wörtliche Zitate, sondern auch sämtliche Ideen, die aus anderen Texten oder von anderen Wissenschaftler*innen übernommen werden. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wobei wichtig ist, dass du dich konsequent für eine Variante entscheidest:
Für die folgenden Angaben gilt, dass es zwar festgelegte Normen gibt, diese aber nur selten umgesetzt werden. So haben zum Beispiel Verlage oder Zeitschriften ihre jeweils ganz eigenen Regeln, an die du dich dann eben halten musst. Für die Uni gilt: mach es so wie sich die Dozent*innen das gerade wünschen. Für mich gilt: mach es einheitlich und so das ich nachvollziehen kann, um welches Werk es sich handelt.
- Angabe der Textstellen im Text
Autor (nur Nachname), Erscheinungsjahr des zitierten Werkes und Seitenzahl werden in Klammern unmittelbar nach dem Zitat angeführt.: z.B.: (Schneider 2014:231) - Angabe der Textstelle in Fußnoten
Autor (Vor- und Nachname). Titel. Erscheinungsort und -jahr des zitierten Werkes sowie die Seitenzahl werden bei der ersten Erwähnung einer Quelle als Kurztitel angeführt und im Literaturverzeichnis vollständig angegeben. Z.B.: 1
_______________________________
1 Schneider: Podcastgeschichte, S.231.
Wird derselbe Titel in unmittelbar aufeinander folgenden Fußnoten erwähnt, reicht ein schlichtes ibid. oder ebd. aus und, sofern die Seitenangabe nicht mit der vorherigen identisch ist, die entsprechende Seite.
Für welche dieser beiden Varianten du dich entscheidest, spielt für mich keine Rolle. Ich halte auch nichts von den seltsamen Reinheitsgedanken einiger Verlage, die der Ansicht sind Fußnoten sollten möglichst vermieden werden und aller Text im Haupttext stehen. Dies tut so, als gingen alle Überlegungen in einem linearen Text auf, was sich in Bezug auf fast jedes Thema als unwissenschaftlich erweist. Deshalb kann ein Text neben Fußnoten auch Textboxen enthalten oder in freier Gestaltung über die Seite verteilt sein, solange dies mit der wissenschaftlichen Darstellung seines Themas in Verbindung steht.
Bibliographieren und Literaturverzeichnis
Auch für die folgenden Angaben gilt, dass es zwar festgelegte Normen gibt, diese aber nur selten umgesetzt werden. So haben zum Beispiel Verlage oder Zeitschriften ihre jeweils ganz eigenen Regeln, an die du dich dann eben halten musst. Für die Uni gilt: mach es so wie sich die Dozent*innen das gerade wünschen. Für mich gilt: mach es einheitlich und so das ich nachvollziehen kann, um welches Werk es sich handelt.
Die Literaturangaben sind alphabetisch nach Nachnamen der Autor*innen bzw. Herausgeber*innen sowie in der Abfolge des Erscheinungsjahres der jeweiligen Publikation anzuordnen.
Folgende Formate haben sich bewährt:
Monographien:
Name, Vorname. [ab 2. Ausgabe diese als Nummer hochgestellt vor dem Erscheinungsjahr]Erscheinungsjahr. Titel und ggf. Untertitel. Erscheinungsort.
Oder
Name, Vorname. Titel und ggf. Untertitel. Erscheinungsort [ab 2. Ausgabe diese als Nummer hochgestellt vor dem Erscheinungsjahr] Erscheinungsjahr.
Zeitschriftenartikel:
Name, Vorname. Erscheinungsjahr. „Titel und ggf. Untertitel.“ Titel der Zeitschrift Bandnr. (Heft), Seitenzahlen. Oder Name, Vorname. „Titel und ggf. Untertitel.“ Titel der Zeitschrift Bandnr. (Heft), Erscheinungsjahr, Seitenzahlen.
Artikel in Büchern:
Name, Vorname. Erscheinungsjahr. „Titel und ggf. Untertitel.“ In: Vor- und Nachname des Herausgebers (Hg., bei mehreren Herausgebern Hgg.). Titel und ggf. Untertitel. Erscheinungsort, Seitenzahlen.
Oder
Name, Vorname. „Titel und ggf. Untertitel.“ In: Vor- und Nachname des Herausgebers (Hg., bei mehreren Herausgebern Hgg.). Titel und ggf. Untertitel. Erscheinungsort Erscheinungsjahr, Seitenzahlen.
Internetquellen:
Name, Vorname. Erscheinungsjahr [sofern vorhanden]. „Titel und ggf. Untertitel“. <Hyperlink> (Downloaddatum).
Oder:
Name, Vorname. „Titel und ggf. Untertitel“. <Hyperlink> Erscheinungsjahr [sofern vorhanden]. (Downloaddatum).
Fernsehen:
„Name der Produktion“. Sender, Produktionsfirma. ggf. Staffel und Episode (Produktionsjahr).
Film:
Regie-Name, Vorname. „Titel des Films“. Produktionsfirma (Produktionsjahr).
Hörspiel:
Autor*in-Name, Vorname. „Titel des Hörspiels“. Sender bzw. Autorenproduktion (Produktionsjahr).
Game:
„Titel des Games“. Entwicklerstudio oder Entwicklernamen (Releasejahr).
Wenn Du bestimmte Sequenzen im Fließtext zitieren möchtest, ergänze hinter deren Angabe den jeweiligen Timecode (abgekürzt mit TC) im Format hh:mm:ss. Dafür ist es sehr wichtig auf die genaue Quelle zu verweisen, die du benutzt hast. Der Timecode für ein im Radio mitgeschnittenes Hörspiel kann anders sein als der Timecode für ein von CD gehörtes Hörspiel.
Für Computerspiele funktioniert der Timecode selbstverständlich nicht. Hier sollte wenn möglich die genaue Szene der genaue Ort innerhalb des Spiels angegeben werden und darüber hinaus die Handlungen oder der Handlung Zusammenhang um den es geht. Ein Umweg wäre möglich, für den sich der Timecode doch nutzen lässt, indem ein Let’sPlay als Beleg herangezogen wird.